- Was bedeutet „Gleichheit“ überhaupt?
- Ungleichheit in der Praxis: Beispiele und Probleme
- Philosophische Perspektiven: Wie können wir eine gerechtere Gesellschaft gestalten?
- Philosophische Wurzeln: Warum manche denken, dass nicht alle Menschen gleich sind
Die Straßenlaternen warfen lange Schatten auf den Bürgersteig. Der Asphalt glänzte noch leicht nach einem Regenschauer, und irgendwo in der Ferne hörte man das dumpfe Brummen eines vorbeifahrenden Autos. Es war eine dieser Nächte, in denen die Stadt sich still anfühlte – als hätte sie sich für ein paar Stunden schlafen gelegt. Nur das entfernte Klirren von Flaschen und das gedämpfte Lachen einer Gruppe Jugendlicher in einer Nebenstraße verrieten, dass es eine lange Nacht gewesen war.
Lena zog ihre Jacke enger um sich und sah über ihre Schulter. Ihre Schritte waren schneller als die von Max, der entspannt neben ihr her trottete, die Hände tief in den Taschen.
„Sag mal, warum guckst du dich eigentlich alle paar Sekunden um? Erwartest du jemanden?“, fragte Max und schielte zu ihr rüber.
Lena atmete hörbar aus. „Nein.“
„Warum bist du dann so angespannt? Wir sind fast zu Hause.“ Max runzelte die Stirn.
Lena blieb stehen. Sie schaute die dunkle Straße entlang, die vor ihnen lag. Die nächste Laterne war ein paar Meter entfernt, danach kam eine kleine Unterführung, die immer nach feuchtem Beton roch. Tagsüber war das kein Problem. Nachts fühlte es sich an wie ein Korridor ohne Fluchtweg.
„Wenn du allein wärst – würdest du dir Gedanken machen?“, fragte sie schließlich.
Max überlegte kurz und zuckte dann mit den Schultern. „Nö. Ich lauf einfach nach Hause. Ist doch nicht weit.“
„Und genau das ist der Unterschied.“
Max schwieg einen Moment. „Du meinst, du hast Angst, dass hier einer aus dem Gebüsch springt?“
Lena schnaubte. „So plump muss es gar nicht sein. Es reicht schon, wenn einer hinter mir geht und schneller wird. Oder wenn einer ruft. Oder wenn ein Auto langsam neben mir herfährt. Es gibt diese Momente, in denen du einfach weißt, dass du in Sekunden hilflos werden kannst. Und genau das spukt dir ständig im Kopf herum.“
Max ließ den Blick die Straße entlang wandern. Die dunklen Hauseingänge, die verwinkelten Ecken; er versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, nicht einfach nur nach Hause gehen zu können, sondern jede Bewegung um sich herum zu scannen.
„Aber findest du nicht, dass du ein kleines bisschen übertreibst? Hier ist doch nichts.“
Lena schüttelte den Kopf. „Für dich ist hier nichts. Für mich ist hier eine einsame Straße und das Risiko, dass irgendjemand hinter mir auftaucht, den ich lieber nicht treffen will.“ Lena sieht Max ernst an. „Hast du mal daran gedacht, dass du nachts allein nach Hause gehen kannst, ohne ständig darüber nachzudenken, ob jemand hinter dir herläuft? Ich schon. Jeden verdammten Abend.“
Max überlegte. „Und du meinst, das geht allen Frauen so?“
Lena lachte auf. „Ich kenne nicht eine, die sich darüber keine Gedanken macht.“
„Darüber hab ich nie nachgedacht“, sagte Max.
Lena seufzte. „Und deshalb geht es nicht nur um Angst. Es geht um eine Ungleichheit, die du nicht siehst, weil du sie nicht erleben musst. Du kannst dich frei bewegen, während ich ständig auf der Hut bin. Du kannst in einer Runde von Männern reden, ohne dass einer dein Aussehen kommentiert. Du kannst dich für Jobs bewerben, ohne dass jemand denkt, du gehörst da nicht hin.“
Max hob eine Augenbraue. „Worauf willst du hinaus?“
Lena zögerte kurz. Dann schüttelte sie den Kopf und lachte bitter. „Ach, nichts. Nur so ein Beispiel. Ich hab mich vor Kurzem für einen Nebenjob beworben. Technische Beratung bei Saturn.“
„Ach echt?“ Max pfiff anerkennend durch die Zähne. „Krass, davon wusste ich gar nichts. Und – hast du ihn bekommen?“
Lena lachte trocken. „Nee. Hat ein Typ bekommen. Paul. Ich kenn ihn aus einem Seminar.“
Max verzog das Gesicht. „Oof. Okay, aber vielleicht war er einfach besser geeignet?“
„Besser?“ Lena verschränkte die Arme. „Max, ich hab zwei Jahre lang im Repair-Café an der Uni gearbeitet. Ich kann PCs auseinander- und wieder zusammenbauen. Ich hab ein Zertifikat für IT-Support. Ich weiß, wie man Menschen technische Dinge erklärt. Und Paul? Der hat letztes Semester mal ein Praktikum im Verkauf gemacht. Das war’s.“
Max kratzte sich am Kopf. „Okay … das klingt schon ziemlich unfair.“
„Es ist unfair. Sie haben ihn nicht genommen, weil er besser ist, sondern weil der Chef keine Frau für den Job wollte“, sagt Lena nüchtern. „Weißt du, wie oft ich in Technikläden von Verkäufern ignoriert werde, während sie sich an den nächstbesten Typen wenden? Glaub mir, das ist kein Zufall.“
Max kickte einen Stein über den Asphalt. „Puh. Ist echt schräg, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine – es ist einfach so normal, dass wir’s nicht mal merken.“
Lena sah ihn an. „Ja. Aber nur, wenn man nicht die Person ist, die dadurch benachteiligt wird.“
Max schwieg eine Weile. Dann sagte er leise: „Das ist echt übel.“
Lena nickte. „Ja.“
Sie gingen weiter. Diesmal blieb Max neben ihr, und seine Schritte klangen ein kleines bisschen wachsamer als vorher.

Was bedeutet „Gleichheit“ überhaupt?
Was heißt es eigentlich, gleich zu sein? Bedeutet es, dass alle Menschen genau dieselben Fähigkeiten haben? Dieselben Bedürfnisse? Oder geht es um etwas anderes – darum, dass alle Menschen die gleichen Chancen bekommen sollten, egal, woher sie kommen, welches Geschlecht sie haben oder wie sie aussehen?
Der Gedanke, dass alle Menschen gleich sind, ist so alt wie die Philosophie selbst. Doch im Alltag merken wir oft: Gleichheit ist nicht so einfach. Denn selbst wenn wir sagen, dass alle gleich sind, erleben wir immer wieder, dass einige mehr Vorteile haben als andere. Lenas Erfahrungen sind da kein Einzelfall. Vielleicht kennst du das Gefühl auch, wenn Mädchen in Mathe oder Physik weniger zugetraut wird – oder umgekehrt Jungen in Kunst oder Sprachen. Alltägliches Beispiel.
Gleich sein oder gleich behandelt werden?
Hierin steckt ein wichtiger Unterschied: Gleich sein heißt nicht automatisch, gleich behandelt zu werden. Ein Klassiker: Stell dir vor, zwei Menschen stehen vor einer hohen Mauer und wollen drüberschauen. Der eine ist groß, der andere klein. Würde man beiden exakt gleich hohe Hocker geben, könnte der Große problemlos über die Mauer sehen – aber der Kleine hätte immer noch keine Chance. Genau darin liegt der Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit: Während Gleichheit meint, dass alle dasselbe erhalten, fragt Gerechtigkeit, was jeder Einzelne benötigt, um tatsächlich teilhaben zu können. Gleichberechtigung bedeutet also nicht, jedem genau dasselbe zu geben, sondern jedem das, was er oder sie braucht, um dieselben Chancen zu haben.
Das ist in vielen Bereichen so: Im Sport gibt es Gewichtsklassen, weil ein Federgewichtler keine Chance gegen einen Schwergewichtler hätte. In der Schule gibt es Nachteilsausgleiche für Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche. Und trotzdem tun wir uns schwer, das auf größere gesellschaftliche Fragen anzuwenden – sei es in Bezug auf Geschlecht, Herkunft oder soziale Schichten.
Gleichheit ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und sie betrifft uns alle – ob wir es merken oder nicht. Vielleicht hast du Eltern, die dir fast alles, was du dir wünschst, finanziell ermöglichen können, und du denkst gar nicht darüber nach, wie diese Förderung dich von Kindern, die keine wohlhabende Familie haben, unterscheidet. Für dich ist es einfach normal. Also, lass uns gemeinsam eintauchen und herausfinden, was es wirklich bedeutet, in einer Welt zu leben, in der nicht alle gleich sind, aber alle gleich behandelt werden sollten.
Ungleichheit in der Praxis: Beispiele und Probleme
Rassismus: Von Apartheid bis zum Alltag
„Du kannst nicht hier sitzen.“ Du gehst mit deiner besten Freundin in ein Café, aber die Bedienung sagt ihr, sie solle sich woanders hinsetzen – weil sie eine andere Hautfarbe hat. Absurd, oder? Doch genau das war in Südafrika bis vor wenigen Jahrzehnten bittere Realität.
Apartheid in Südafrika: Wenn Gesetze Ungleichheit festschreiben
Bis 1994 galt in Südafrika die Apartheid, ein System der Rassentrennung. Menschen wurden nach Hautfarbe in unterschiedliche Kategorien eingeteilt – mit harten Konsequenzen: Schwarze Südafrikaner/innen durften nicht die gleichen Schulen besuchen wie Weiße, nicht in denselben Bussen sitzen und nicht einmal auf denselben Parkbänken ausruhen. Selbst Liebe war geregelt: Ehen zwischen Schwarzen und Weißen waren verboten.
Hinter dieser absurden Trennung steckte eine Ideologie: Weiße Menschen hielten sich für überlegen und versuchten, ihre Macht zu sichern. Der Staat schrieb Ungleichheit also nicht nur vor, sondern verteidigte sie aktiv mit Gesetzen, Polizei und Gewalt.
Die Apartheid ist erst seit ca. 30 Jahren abgeschafft. 1994 wurde Nelson Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas – nach 27 Jahren Gefängnis wegen seines Widerstands gegen das System. Dass wir heute über Apartheid als „Geschichte“ sprechen, zeigt auch, wie jung der Kampf gegen Rassismus eigentlich ist.
Alltagsrassismus: Wenn Ungleichheit sich versteckt
Okay, Apartheid gibt es nicht mehr – aber Rassismus? Leider ja. Und das Problem ist: Er taucht nicht immer in offensichtlichen Formen auf. Manchmal ist er leise, unscheinbar und trotzdem verletzend.
Ein paar Beispiele aus dem Alltag:
- In der Schule: „Ich dachte, du hast in Mathe mehr Schwierigkeiten“ – Solche Aussagen von Lehrern beruhen auf Vorteilen gegenüber kulturellen oder ethnischen Hintergründen.
- Beim Feiern: „Du sprichst aber richtig gut Deutsch. Woher kommst du eigentlich?“ – wenn jemand aufgrund seines Aussehens nicht automatisch als „deutsch“ angesehen wird.
- Im Netz: Unter einem TikTok-Video mit einer BIPoC-Creatorin (Black, Indigenous, Person of Color) tauchen Kommentare auf wie: „Geh doch zurück in dein Land!“ – obwohl sie hier geboren ist.
- Beim Bewerbungsgespräch: Zwei Leute haben denselben Lebenslauf – aber nur der mit dem „deutschen“ Namen wird eingeladen.
Alltagsrassismus ist so normalisiert, dass er vielen gar nicht auffällt, und oft meinen Leute solche Dinge „gar nicht böse“ – aber für die Betroffenen fühlt es sich eben nicht witzig an, sondern ausgrenzend.
Rassismus – ein Problem von anderen? Oder auch deins?
Jetzt die große Frage: Hast du selbst schon mal Rassismus erlebt oder mitbekommen? Vielleicht in der Schule, im Sportverein oder in einem Insta-Kommentar? Und wenn ja – wie hast du reagiert?
Denn das Ding ist: Rassismus ist nicht nur ein Problem der Betroffenen, sondern der gesamten Gesellschaft. Es geht nicht nur darum, nicht rassistisch zu sein – sondern auch darum, Rassismus zu erkennen und sich aktiv dagegenzustellen.
Was kannst du tun? Manchmal reicht es schon, blöde Sprüche nicht unkommentiert zu lassen. Oder jemandem, der ausgeschlossen wird, zu zeigen: Hey, ich sehe dich – du gehörst dazu.

Sexismus: Gibt es Gleichberechtigung von Frauen und Männern?
„Mädchen sind halt einfach nicht so gut in Naturwissenschaften.“
Solche Sätze fallen auch heute noch – in Klassenzimmern, auf Social Media oder in Familien. Und sie zeigen: Obwohl wir offiziell in einer Zeit der Gleichberechtigung leben, gibt es immer noch Denkweisen, die Mädchen und Frauen kleinhalten.
Sexismus bedeutet, dass jemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt oder herabgesetzt wird – meist Frauen, Männer betrifft das manchmal jedoch auch, zum Beispiel, wenn es um Vaterschaft und Kindererziehung geht oder um die Frage, ob sie Nagellack tragen dürfen, ohne unmännlich zu sein. Sexismus kann ganz offen passieren, etwa durch Beleidigungen oder ungleiche Bezahlung. Oft zeigt sich Sexismus aber in scheinbar harmlosen Kleinigkeiten: in einem „Das kannst du als Mädchen doch nicht“, in Werbung, die Frauen als Deko zeigt, oder in der Erwartung, dass Jungs immer stark und cool zu sein haben. Solche Botschaften wirken unauffällig – aber sie prägen, was Menschen sich selbst und anderen zutrauen.
Und genau hier beginnt das Problem: Wenn solche Vorurteile über Jahrhunderte weitergegeben werden, entstehen Strukturen, die man kaum noch hinterfragt. Viele Frauen haben das irgendwann nicht mehr hingenommen – und angefangen, dagegenzuhalten. So entstand der Feminismus: aus Wut und dem Wunsch, diese unfaire Schieflage zu beenden.
Feminismus bedeutet nicht, dass Frauen „besser“ als Männer sein wollen. Es geht um etwas Einfacheres und gleichzeitig viel Radikaleres: die gleichen Rechte, die gleichen Möglichkeiten und den gleichen Respekt.
Das klingt für viele von uns heute selbstverständlich, doch das war es lange nicht. Frauen mussten sich die Rechte, die sie heute haben, hart erkämpfen. Und genau hier setzen einige der wichtigsten feministischen Denkerinnen an.
Historischer Rückblick: Drei Frauen, die die Welt veränderten
Olympe de Gouges: Die Revolution vergisst die Frauen
Frankreich, 1789: Die Französische Revolution bricht aus. Es geht um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! Klingt nach einer neuen, besseren Welt, oder?
Doch es gab ein Problem: Die Revolution galt nur für Männer. Frauen sollten weiter schweigen, gehorchen und zu Hause bleiben.
Doch eine Frau wollte das nicht akzeptieren: Olympe de Gouges (*1748). Sie schrieb die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ als Antwort auf die berühmte „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“, in der Frauen gar nicht vorkamen.
Ihr radikalster Gedanke: „Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten.“1
Das war revolutionär – und gefährlich. Olympe de Gouges forderte:
- Das Recht von Frauen, in der Politik mitzubestimmen.
- Gleiche Strafen und gleiche Gesetze für Männer und Frauen.
- Die Abschaffung der Ehe als Besitzverhältnis, also eine Reform des Eheverständnisses. Sie wollte eine Ehe, die auf Freiwilligkeit und Gleichberechtigung beruht.
Doch das war zu viel für ihre Zeit. 1793 wurde sie hingerichtet – unter demselben System, das Freiheit und Gleichheit versprach. Ihr Vermächtnis? Sie zeigte, dass eine Revolution, die Frauen ausschließt, keine echte Revolution ist.

Mary Wollstonecraft: Bildung ist Macht
Wenn Frauen dumm sind, dann nur, weil man sie dumm hält
Wolltest du schon mal eine Sache richtig gut können, aber niemand hat dir zugetraut, dass du es schaffst?
Mary Wollstonecraft (*1759), eine englische Schriftstellerin und Philosophin, kannte dieses Gefühl. Im 18. Jahrhundert war Bildung für Frauen ein Witz. Sie sollten hübsch sein, charmant lächeln, gut kochen – aber Wissen? Denken? Entscheidungen treffen? Das war angeblich Männersache.
Dann stellte Mary Wollstonecraft eine provokante Frage: Woher wollen Männer eigentlich wissen, dass Frauen weniger Verstand haben – wenn Frauen nie dieselbe Bildung bekommen?
Wollstonecraft war Philosophin der Aufklärung – sie glaubte wie Kant oder Rousseau an die Kraft der Vernunft. Doch während viele ihrer männlichen Kollegen Vernunft für sich beanspruchten, fragte sie:
Wenn Vernunft das ist, was den Menschen zum Menschen macht – warum sollte sie bei Frauen aufhören?
Damit stellte sie die gesamte gesellschaftliche Ordnung infrage.
Sie argumentierte: Frauen wirken nur „dümmer“ oder „emotionaler“, weil man sie systematisch davon abhält, ihren Verstand zu benutzen. Man erzieht sie dazu, gefällig zu sein, statt frei zu denken. Das Ergebnis? Eine Gesellschaft, in der Männer herrschen – und Frauen lernen, sich selbst kleinzumachen.
In ihrem Buch „Verteidigung der Rechte der Frau“ (1792) forderte sie:
- Mädchen müssen die gleiche Bildung bekommen wie Jungen. Ohne Wissen keine Unabhängigkeit!
- Frauen sollen nicht nur für das Vergnügen der Männer existieren. Sie sind Menschen mit eigenen Zielen und Talenten.
- Gleichberechtigung beginnt im Kopf. Frauen müssen sich selbst als gleichwertig betrachten – erst dann ändert sich die Gesellschaft.
Was sie sagte, war damals rebellisch: Frauen haben nicht weniger Verstand als Männer – sie hatten nur nie die Chance, ihn zu entwickeln.
Heute haben Mädchen bei uns Zugang zu Bildung. Aber: Werden sie auch ermutigt, alles zu erreichen, was sie wollen?
Wollstonecrafts Idee ist also nicht bloß: „Gebt Mädchen Schulbücher.“
Ihre Forderung ist radikaler: Bildung als Befreiung.
Erst wenn Frauen lernen dürfen, kritisch zu denken, zu zweifeln und selbst zu urteilen, können sie wirklich gleichberechtigt leben – nicht nur auf dem Papier.
Simone de Beauvoir: Als Frau wird man nicht geboren
Warum denken so viele Menschen noch immer, dass Frauen „einfühlsam“ und „bescheiden“ sein müssen und Männer „stark“? Dass Frauen „hübsch“ und Männer „erfolgreich“ sein sollten?
Genau diese Frage stellte sich die französische Philosophin Simone de Beauvoir (*1908) im Jahr 1949. Und sie kam zu einem radikalen Schluss:
„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“2
Was meinte sie damit?
Geschlecht ist keine Natur – sondern ein Projekt
De Beauvoir war Existenzialistin3, genau wie Jean-Paul Sartre. Für sie gilt: Der Mensch wird nicht durch etwas Vorgegebenes bestimmt – sondern durch das, was er aus sich macht. Das bedeutet: Wir sind nicht einfach „so, wie wir geboren sind“. Wir gestalten uns selbst – durch Entscheidungen, Handlungen, Erfahrungen.
Wenn de Beauvoir also sagt, man wird zur Frau gemacht, meint sie: Mädchen werden in Rollen hineinerzogen. Sie sollen angepasst, hübsch und fürsorglich sein – nicht, weil das in ihren Genen steht, sondern weil die Gesellschaft es so will. So entsteht das, was sie „die Frau als das Andere“ nennt: Frauen werden nicht als eigenständige Menschen gesehen, sondern als Ergänzung zum Mann. Der Mann gilt als das Maß der Dinge – die Frau als „Abweichung“.
Freiheit bedeutet Verantwortung – auch für Frauen
De Beauvoir glaubte: Jeder Mensch hat die Freiheit, sich selbst zu entwerfen. Aber Freiheit ist nicht einfach „machen, was man will“. Sie bedeutet, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Wenn Frauen ihre Freiheit nicht nutzen, weil sie gelernt haben, sich anzupassen, bleiben sie in der Rolle, die andere für sie geschrieben haben.
Für de Beauvoir war das eine doppelte Tragödie: Die Gesellschaft verliert das Potenzial der Frauen – und Frauen verlieren sich selbst.
Ihre Lösung? Bildung, Selbstbewusstsein, Auflehnung.
Frauen müssen sich ihre Freiheit nehmen, weil niemand sie ihnen freiwillig schenkt.
Der männliche Blick prägt die Welt
Fast alles in der Geschichte – Philosophie, Kunst, Wissenschaft – wurde aus männlicher Sicht erzählt. De Beauvoir nannte das den „männlichen Blick“.
Er bestimmt, was als „normal“, „stark“ oder „schön“ gilt. Frauen erscheinen darin oft als Nebenfiguren: die Muse, die Geliebte, die Mutter.4
De Beauvoir zeigte: Wenn die Welt nur durch Männeraugen beschrieben wird, sehen Frauen sich selbst irgendwann auch so – als Spiegelbild, nicht als handelnde Person.
Und heute?
De Beauvoirs Gedanken sind über 70 Jahre alt, aber sie treffen immer noch ins Schwarze. Warum gibt es Spielzeug für Mädchen und für Jungen? Warum ist es „mutig“, ungeschminkt zu sein? Warum müssen Frauen sich erklären, wenn sie keine Kinder wollen?
Viele unserer Vorstellungen von „weiblich“ und „männlich“ sind immer noch kulturelle Drehbücher, keine Naturgesetze. Denn das Geschlecht ist nicht das Problem – sondern die Gesellschaft. Mädchen und Jungen kommen mit ähnlichen Fähigkeiten auf die Welt. Viele Probleme des Feminismus haben folglich mit gesellschaftlichen Erwartungen zu tun – nicht mit Biologie. Und wenn wir diese Erwartungen hinterfragen, können wir viel verändern.
De Beauvoir würde sagen: Frei bist du erst, wenn du aufhörst, so zu sein, wie man dich haben will – und anfängst, du selbst zu werden. Ihr Feminismus ist kein Kampf der Geschlechter, sondern ein Aufruf zur Selbstbestimmung.
Sie fordert, dass Frauen nicht länger „das Andere“ sind – sondern Autorinnen ihres eigenen Lebens, frei, denkend, handelnd.
Und sie erinnert uns daran: Gleichheit beginnt mit der Frage, wer wir sein wollen – und wer wir sein dürfen.
Feminismus heute: Wo gibt es noch Ungleichheit?
1. Die Gehaltslücke: Warum verdienen Frauen immer noch weniger?
Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich 16% weniger als Männer. Selbst wenn man Faktoren wie Teilzeitjobs rausrechnet, bleibt eine Lücke.
2. Rollenbilder: Wer macht den Haushalt?
Frauen arbeiten oft weniger, weil sie „nebenbei“ die ganze Care-Arbeit zu Hause übernehmen. Das führt dazu, dass Männer häufiger und schneller Karriere machen.
3. Die „gläserne Decke“ – Warum gibt es so wenige Chefinnen?
Frauen sind in Top-Positionen krass unterrepräsentiert. In den 200 größten Unternehmen Deutschlands beträgt der Frauenanteil in Vorständen nur 19%.
Und jetzt zu dir: Was heißt für dich Gleichberechtigung?
Wenn jemand sagt: „Frauen und Männer sind gleich“ – was ist damit gemeint?
- Gleiche Rechte – also gleiche Gesetze für alle?
- Gleiche Fähigkeiten – können Frauen alles genauso gut wie Männer?
- Gleiche Chancen – oder müssen Frauen doppelt so hart kämpfen, um das Gleiche zu erreichen?
Denn genau darum geht es beim Feminismus – um Gerechtigkeit.
Also, was denkst du? Sind wir schon da – oder gibt es noch was zu tun?

Speziesismus: Warum behandeln wir Tiere anders als Menschen?
Nehmen wir mal an, du sitzt mit Freunden in einem Restaurant. Die Speisekarte bietet alles Mögliche: Burger, Pizza, Pasta. Eine Freundin bestellt einen Salat, weil sie keine Tiere essen will. Ein anderer Kumpel lacht und sagt: „Jetzt übertreib doch nicht so. Das sind doch nur Tiere.“
Aber was heißt denn „nur“ Tiere?
Wir lieben unsere Haustiere, reden mit ihnen, knuddeln sie, geben ihnen Namen. Ein Hund oder eine Katze wird wie ein Familienmitglied behandelt. Aber ein Schwein, das mindestens genauso intelligent ist wie ein Hund, landet auf dem Teller. Warum gibt es Gesetze gegen Tierquälerei, aber gleichzeitig Massentierhaltung? Wenn es um Nutztiere geht, nehmen wir ihr Leid oft als gegeben hin. Ein Delfin in Gefangenschaft ist eine Tragödie, ein Fisch in der Tiefkühltruhe ist Abendessen.
Irgendwo tief in uns drin haben wir Trennlinien gezogen. Wir behandeln Tiere nicht nur unterschiedlich, sondern grundsätzlich auch anders als Menschen. Ein Baby und ein Pferd fühlen beide Schmerz, wenn sie geschlagen werden. Warum ist es moralisch verwerflich, das Baby zu schlagen, aber beim Pferd sehen viele nicht ein ebenso schlimmes Unrecht?
Das nennt man Speziesismus – wenn die Zugehörigkeit zu einer Art darüber entscheidet, wessen Leben oder Leid wichtig ist. Genau wie Rassismus oder Sexismus stellt Speziesismus bestimmte Gruppen über andere – mit dem Unterschied, dass es hier nicht um Menschen, sondern um Tiere geht. Speziesismus ist also das unhinterfragte Vorrecht des Menschen gegenüber anderen Lebewesen.
Doch viele Philosophen sagen: Wenn wir Tieren moralische Rechte verweigern, tun wir das nicht aus Logik, sondern aus Tradition.
Philosophische Perspektiven: Was sagen Denker dazu?
Peter Singer: Gleiches Leid, gleiche Rechte?
Der australische Philosoph Peter Singer (*1946) ist einer der wichtigsten Vordenker der Tierrechtsbewegung. Sein berühmtes Buch „Animal Liberation“ (deutsch: „Die Befreiung der Tiere“) gilt als Bibel des modernen Antispeziesismus.
Singer stellt eine einfache, aber radikale Frage:
Warum ist das Leid von Tieren weniger wert als das eines Menschen?
Singer sagt: Das ist willkürlich. Es gibt keinen moralischen Grund, warum die Interessen eines Tieres weniger zählen sollten als die von uns Menschen. Tiere empfinden Schmerz. Sie leiden, wenn sie eingesperrt, gequält oder getötet werden. Sie können nicht um Hilfe bitten, aber das macht ihr Leid nicht weniger real. Wenn Leid schlecht ist, spielt es keine Rolle, wer leidet.
Singer zieht eine Parallele zu anderen Diskriminierungsformen:
- Früher hieß es: „Weiße sind wichtiger als Schwarze.“
- Oder: „Männer sind wichtiger als Frauen.“
- Heute heißt es: „Menschen sind wichtiger als Tiere.“
Laut Singer machen wir immer noch denselben Fehler: Wir ziehen künstliche Grenzen und erklären eine Gruppe für weniger wert. Aber nur weil eine Mehrheit eine Minderheit ausbeutet, heißt das nicht, dass es richtig ist.
Sein Hauptargument kommt aus dem Utilitarismus:
- Die Moral einer Handlung wird daran gemessen, ob sie Leid vermeidet oder Glück maximiert.
- Wenn Tiere genauso leiden können wie Menschen, sollte ihr Leid gleich ernst genommen werden.
Konsequenz: Laut Singer ist Massentierhaltung genauso moralisch verwerflich wie Sklaverei. Die Fähigkeit, zu leiden, sollte das entscheidende Kriterium für moralische Berücksichtigung sein – und nicht, ob ein Wesen intelligent ist oder sprechen kann. Denn seit wann ist Intelligenz das Kriterium für Würde? Babys, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen sind auch nicht immer rational oder sprachfähig – trotzdem ist ihr Leben unantastbar.
Singer fordert uns auf, unser Verhalten gegenüber Tieren zu überdenken. Sein Vorschlag: weniger Fleisch essen, keine Tierversuche, mehr Respekt für Tiere.
Aber: Viele Menschen lehnen seine radikale Sicht ab. Was würde es für unser Leben bedeuten, wenn wir Tiere wirklich gleichberechtigt behandeln?
Max: Wenn ich Peter Singer richtig verstehe, müssten wir Tiere so behandeln wie Menschen. Gleiche Rechte, gleiche Rücksicht. Aber … wie soll das gehen? Sollen wir dann auch Hühnern Wahlrecht geben?
Lena (lacht leise): Nein, natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass Tiere dieselben Rechte im juristischen Sinn bekommen. Singer meint lediglich, Schmerz Schmerz ist, egal in welchem Körper.
Max: Okay, aber dann müssten wir unser ganzes Leben umkrempeln. Keine Burger, keine Milch, keine Lederschuhe, keine Zoo-Besuche. Also … ich versteh’s ja – ich würde nie ein Tier absichtlich verletzen. Aber irgendwo muss doch eine Grenze sein, oder?
Lena: Das ist genau der Punkt, den Singer anprangert – diese Grenze. Wir ziehen sie, weil’s bequemer für uns ist. Ich mein, schau dir Humboldt an. (Sie streichelt den alten Hund, der neben ihr döst.) Wir würden ihn um keinen Preis leiden lassen. Aber gleichzeitig ist es gesellschaftlich völlig normal, dass Schweine ihr ganzes Leben in winzigen Boxen verbringen. Warum? Weil wir’s so gewohnt sind.
Max: Ja, aber Humboldt ist schon ewig unser Nachbar. Ein Schwein kenn ich halt nicht persönlich.
Lena: Eben. Wir empfinden Mitgefühl da, wo Nähe ist. Aber moralisch ist das eigentlich kein Argument. Das ist wie zu sagen: „Ich helf nur Leuten in meiner Stadt, die in Afrika kenn ich ja nicht.“ Nur weil du ein Tier nicht kennst, heißt das nicht, dass sein Leid weniger zählt.
Max (nachdenklich): Hm. Aber irgendwo hab ich auch Schiss vor so einer totalen Konsequenz. Wenn man das alles ernst nimmt, bleibt ja kaum noch irgendwas übrig, was wir tun dürfen. Ist das nicht … überfordernd? Also moralisch?
Lena: Total verständlich. Ich glaub, Singer will auch gar nicht, dass wir perfekt sind. Sondern dass wir bewusster werden. Jeder Schritt zählt. Weniger Fleisch essen, nicht alles als selbstverständlich nehmen. Es geht nicht darum, ein Heiliger zu sein, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen.
Max: Trotzdem – wenn du’s zu Ende denkst, ist das irgendwie deprimierend. Ich mein, wir leben in einer Welt, die auf Ungleichheit basiert. Menschen über Tiere, Reiche über Arme … Wo fängt man da an?
Lena: Vielleicht genau da, wo man’s merkt. Beim Essen, beim Einkaufen, beim Reden. Philosophie heißt ja nicht, dass man die Welt über Nacht verändert, sondern dass man sie nicht mehr blind hinnimmt.
Max (lehnt sich zurück): Du meinst, es geht mehr ums Hinschauen als ums Perfektsein?
Lena: Genau. Singer sagt ja nicht: „Werd Vegetarier, sonst bist du böse.“ Er sagt: „Schau hin. Und triff deine Entscheidung mit offenen Augen.“ Das ist das eigentlich Menschliche – zu reflektieren, was man tut. Tiere können das nicht. Wir schon. Das verpflichtet uns.
Max: Hm. Klingt irgendwie fair. Und trotzdem – ich glaub, Humboldt würde mich hassen, wenn ich sein Futter jetzt plötzlich moralisch bewerte.
Lena (grinst): Keine Sorge, der alte Philosoph da frisst eh nur das, was er will. Vielleicht ist er der wahre Utilitarist hier: maximales Glück, minimaler Aufwand.
Max (lacht): Aber im Ernst. Vielleicht fang ich einfach mal an, bewusster zu essen. Ohne gleich die Welt retten zu müssen.
Lena: Das wär schon ein ziemlich guter Anfang, kleiner Bruder.
Max: Pff. Du meinst, ich soll moralisch wachsen wie ’n Baum – langsam, aber in die richtige Richtung?
Lena (lächelt): Ganz genau. Und wer weiß – vielleicht wird aus dir ja doch noch ein Singer-Schüler.
Max: Na toll. Dann bin ich also der erste philosophierende Skater mit Tierschutzkrise. Super Image.
Lena: Warte ab. Vielleicht ist das genau die Art von Revolution, die wir brauchen.
René Descartes: Sind Tiere nur Maschinen?
Nicht alle Philosophen waren so tierfreundlich wie Singer. Der berühmte Rationalist René Descartes (*1596) vertrat eine radikale Gegenposition. Sein berühmtes Konzept „Cogito, ergo sum“ („Ich denke, also bin ich“) machte den menschlichen Verstand zum Zentrum der Philosophie.
- Für ihn waren Tiere automatische, biologische Maschinen – ohne Bewusstsein, ohne Seele. Ihr Verhalten sei rein mechanisch, eine Reflexreaktion auf Reize.
- Sie können sich bewegen, Laute machen – aber das bedeute nicht, dass sie wirklich fühlen oder denken.
- Menschen haben eine Seele, Tiere nicht – also gibt es laut Descartes keinen Grund, sie moralisch zu berücksichtigen.
Seine Sicht hatte katastrophale Folgen:
- Sie legte den Grundstein für viele spätere wissenschaftliche und wirtschaftliche Praktiken, in denen Tiere als reine Ressourcen betrachtet wurden.
- Sie beeinflusste jahrhundertelang die Wissenschaft und Rechtsprechung. Tiere hatten keinerlei moralischen Status.
- Tiere galten nicht als leidensfähige Wesen, sondern als Werkzeuge. Deshalb konnten sie ohne moralische Bedenken für Experimente, Arbeit oder Essen benutzt werden.
Allerdings hat die moderne Forschung gezeigt, dass Descartes falsch lag. Tiere empfinden Schmerz, haben ein Bewusstsein, komplexe Emotionen, Erinnerungen und soziale Bindungen. Descartes’ Sichtweise ist also längst überholt – aber ihre Auswirkungen sind noch heute in der Massentierhaltung und Tierversuchen spürbar. Descartes’ Denken steckt tief in unserer Kultur.
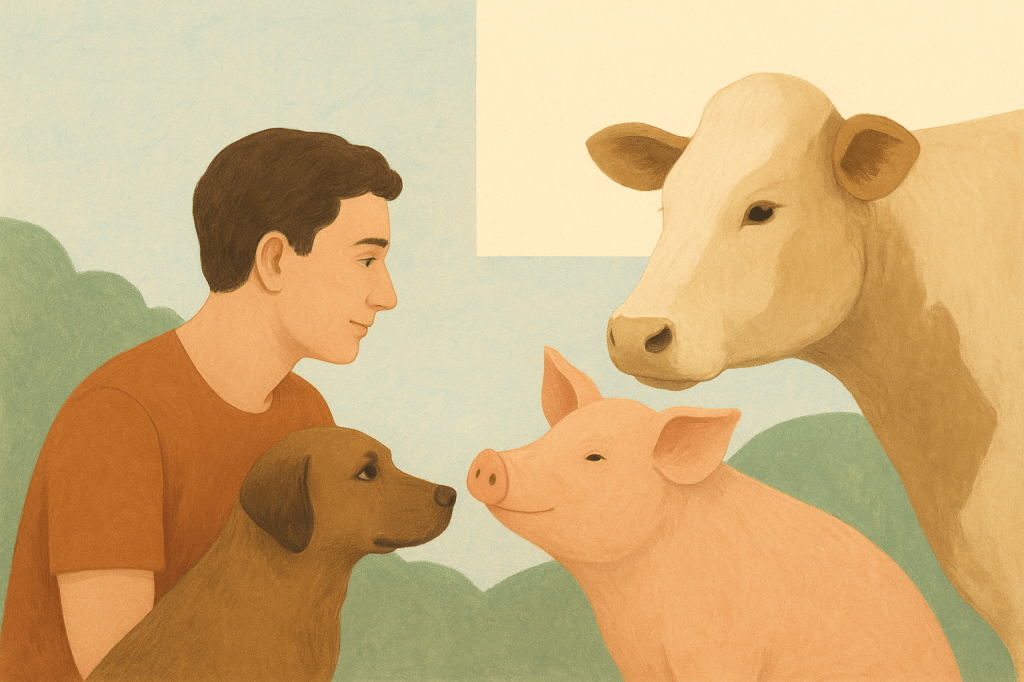
Ableismus: Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
Stell dir vor, du gehst mit einer Freundin, die einen Rollstuhl benutzt, in ein Restaurant. Die Tür ist zu eng, es gibt keine Rampe, und die Toilette ist im ersten Stock – ohne Aufzug. Der Kellner schaut sie mitleidig an und spricht nicht mit ihr, sondern mit dir: „Und was möchte sie trinken?“
Oder nehmen wir mal an, du hast eine nicht sichtbare Behinderung, zum Beispiel eine chronische Erkrankung, womöglich eine psychische. Andere erwarten, dass du „einfach normal funktionierst“. Wenn du dich zurückziehst oder bestimmte Dinge anders machst, wird das als unhöflich oder unangemessen empfunden. Dein Verhalten verärgert deine Mitmenschen.
Das sind Beispiele für Ableismus – eine Form der Diskriminierung, die Menschen mit Behinderungen systematisch benachteiligt, oft ohne dass es anderen bewusst ist. Dabei geht es nicht nur um offensichtliche Barrieren wie fehlende Rampen, sondern auch um gesellschaftliche Vorurteile, stereotype Erwartungen und eine Gesellschaft, die oft so gestaltet ist, dass sie viele Menschen ausschließt.
Was ist Ableismus?
Der Begriff Ableismus kommt vom englischen „able“ (fähig) und bezeichnet die Diskriminierung oder Benachteiligung von Menschen aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Menschen ohne Behinderung gelten als „normal“, Menschen mit Behinderung als „mangelhaft“.
Aber was bedeutet das konkret?
Ableismus kann auf verschiedene Arten auftreten:
- Physische Barrieren: Gebäude, die nicht barrierefrei sind, fehlende Untertitel für gehörlose Menschen, fehlende Blindenleitsysteme.
- Soziale Vorurteile: Die Annahme, dass Menschen mit Behinderung nicht selbstständig sein können oder bemitleidenswert sind.
- Strukturelle Benachteiligung: Schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung oder bei Versicherungen.
Meine jüngere Tochter besucht zum Beispiel seit diesem Sommer die Grundschule. Ein Ort, an dem Hunderte von Schüler/innen gemeinsam lernen, spielen, toben. Eine Umgebung, in der sie viele Erfahrungen zum allerersten Mal machen, was sie miteinander verbindet. Wenn ich aber meine Tochter in ihrem Klassenraum abhole und die 6 Treppen nach oben keuche, muss ich oft an die Kinder denken, die womöglich auf einen Rollstuhl angewiesen sind und allein darum niemals Teil dieser Gemeinschaft sein können. Sie werden sozusagen aussortiert, sind nicht sichtbar in diesem Raum für „normale“ Kinder. Das macht mich traurig.
Ableismus ist nicht nur eine Frage persönlicher Vorurteile, sondern tief in den Strukturen der Gesellschaft verankert. Aber es gibt Möglichkeiten, ihn abzubauen.
Eine Gesellschaft ist nicht gerecht, wenn sie nur für „die Normalen“ funktioniert.
Philosophische Perspektiven: Wie können wir eine gerechtere Gesellschaft gestalten?
Martha Nussbaum und der Capabilities Approach
Echte Chancen für alle
Die US-Amerikanerin Martha Nussbaum (*1947) ist gegenwärtig eine der wichtigsten Philosophinnen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Ihr Capabilities Approach (Fähigkeiten-Ansatz) fragt: Was braucht ein Mensch, um ein erfülltes Leben zu führen – unabhängig von seinen körperlichen oder geistigen Voraussetzungen? Was macht ein Leben wirklich lebenswert? Und was bringen Rechte auf dem Papier, wenn man sie im Alltag gar nicht nutzen kann?
Warum „Gleichheit“ oft zu kurz greift
Nussbaum kritisiert: Viele Theorien der Gerechtigkeit – auch die berühmte von John Rawls5 – betrachten Menschen als abstrakte, gleiche Wesen. Doch in der Realität sind Menschen verschieden: in ihren Körpern, Fähigkeiten, Lebenslagen. Wenn man also allen dasselbe gibt, ohne ihre Unterschiede zu berücksichtigen, bleiben viele trotzdem ausgeschlossen.
Beispiel: Ein gehörloser Schüler hat formal die gleichen Rechte wie alle anderen. Doch was bringt ihm das, wenn der Unterricht nur in gesprochener Sprache stattfindet? Gleichheit (oder Gleichbehandlung) bedeutet hier nicht Gerechtigkeit – sie kann sogar Ungerechtigkeit verdecken.
Der Fähigkeiten-Ansatz (Capabilities Approach)
Nussbaum schlägt deshalb Folgendes vor:
Gerechtigkeit bedeutet, allen Menschen reale Möglichkeiten zu geben, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Nicht bloß theoretisch, sondern praktisch.
Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn jeder Mensch die Chance hat, das zu tun, was ein menschliches Leben ausmacht – unabhängig von Behinderung, Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status.
Dazu nennt Nussbaum zehn grundlegende „Capabilities“, also Fähigkeiten, die jedes Leben ermöglichen sollen. Zum Beispiel:
- Leben in Würde und ohne Gewalt
- Gesundheit und körperliche Integrität
- Bildung und Vorstellungskraft
- Emotionale Bindungen und Zugehörigkeit
- Mitbestimmung in Politik und Gesellschaft
Diese Fähigkeiten sind kein Luxus, sondern das Minimum, damit ein Mensch wirklich Mensch sein kann.
Gerechtigkeit ist konkret – nicht theoretisch
Für Nussbaum reicht es nicht, abstrakte Prinzipien aufzustellen. Sie will, dass Philosophie in der Realität wirkt.
Eine gerechte Gesellschaft erkennt ihre Schwachen nicht als „Last“, sondern als Maßstab für Menschlichkeit.
Das bedeutet:
- Barrierefreie Schulen und Universitäten sind kein Bonus, sondern Grundvoraussetzung.
- Flexible Arbeitszeiten für chronisch Kranke sind kein Entgegenkommen, sondern Gerechtigkeit.
- Gleiche Chancen für Frauen, Arme oder Geflüchtete sind kein „Extra“, sondern moralische Pflicht.
Nussbaums Ethik der Menschlichkeit
Hinter ihrem Ansatz steckt ein humanistisches Menschenbild: Jeder Mensch hat Würde – nicht, weil er „leistet“, sondern weil er fühlen, denken, träumen kann. Ihre Philosophie verbindet also Aristoteles (der das gute Leben als Entfaltung menschlicher Fähigkeiten sah) mit moderner Menschenrechtsethik.
So entsteht ein Gerechtigkeitsbegriff, der nicht auf Gleichmacherei, sondern auf individuelle Entfaltung setzt.
Oder, wie Nussbaum sagen würde: Gerechtigkeit heißt, jedem zu ermöglichen, das zu sein, was er oder sie sein kann.
Martha Nussbaum macht Philosophie wieder menschlich. Sie erinnert uns daran, dass Gleichheit nicht auf dem Papier beginnt, sondern im Alltag jedes einzelnen Menschen. Ihr Fähigkeiten-Ansatz ist kein abstraktes System – sondern eine Einladung, Gesellschaft so zu gestalten, dass niemand zurückbleibt.
Rosemarie Garland-Thomson und Susan Wendell
Wer bestimmt eigentlich, was „normal“ ist?
Der Körper als politisches Thema
Die US-amerikanischen Philosophinnen Rosemarie Garland-Thomson (*1946) und Susan Wendell (*1945) haben Ableismus aus einer feministischen Perspektive6 untersucht. Ihr zentraler Punkt: Behinderung ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt.
Was bedeutet das? Ganz einfach:
Nicht die Behinderung selbst schränkt Menschen ein – sondern eine Welt, die nicht für sie gemacht ist.
Was „normal“ heißt – und wer das entscheidet
Garland-Thomson spricht von der „Normgesellschaft“: Wir haben ein Bild davon, was ein „normaler Körper“ ist – jung, gesund, leistungsfähig. Wer da nicht reinpasst, gilt als „abweichend“. Menschen mit Behinderung werden oft als „Leidende“ gesehen, die entweder bemitleidet oder als „inspirierend“ gefeiert werden, wenn sie alltägliche Dinge tun.
Das Problem: Diese Sichtweise verstärkt Ableismus, weil sie Menschen mit Behinderung entweder zu hilflosen Opfern oder zu außergewöhnlichen Kämpfern macht – anstatt sie einfach als Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu sehen.
Garland-Thomson und Wendell sagen außerdem: Der Körper ist nie privat.
Er ist politisch – weil er bestimmt, wie man behandelt wird.
So wie Simone de Beauvoir gezeigt hat, dass „Frau-Sein“ kein biologisches Schicksal ist, gilt das auch für Behinderung: Nicht der Körper selbst ist das Problem, sondern die Gesellschaft.
Wenn alle Gebäude barrierefrei wären, wäre ein Rollstuhl dann noch ein Nachteil?
Behinderung entsteht also erst durch die Umwelt, nicht durch den Körper.
Behinderung ist damit kein „Defekt“, sondern ein Hinweis darauf, dass die Welt ungerecht gebaut ist.
Susan Wendell: Die Unsichtbaren
Susan Wendell bringt eine weitere Dimension ins Spiel: die Verletzlichkeit.
Die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir leistungsfähig sind. Wer das nicht ist, fällt aus dem Raster. Deshalb erleben Menschen mit chronischen Krankheiten oft Unsichtbarkeit: Ihre Behinderung ist nicht offensichtlich, aber sie haben trotzdem große Einschränkungen – und müssen sich immer wieder rechtfertigen. Wer krank, müde oder auf Hilfe angewiesen ist, passt nicht in das System.
Wendell nennt das die „Illusion des autonomen Subjekts“ – also die Idee, dass ein Mensch völlig unabhängig und rational durchs Leben geht.
Aber ehrlich: So funktioniert kein Mensch. Wir alle sind auf andere angewiesen – emotional, körperlich, sozial.
Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit zeigen uns nicht unsere Schwäche, sondern unsere Menschlichkeit.
Was das philosophisch bedeutet
Garland-Thomson und Wendell fordern eine neue Art von Philosophie – eine, die den Körper endlich ernst nimmt. Nicht als Hindernis, sondern als Teil des Denkens, des Lebens, der Welt.
Ihre Botschaft:
- Behinderung ist kein Sonderfall, sondern Teil der menschlichen Vielfalt. Erst wenn wir akzeptieren, dass kein Körper perfekt und keiner falsch ist, wird Menschlichkeit wirklich inklusiv.
- Eine gerechte Gesellschaft misst sich daran, wie gut sie mit Verschiedenheit umgehen kann.
- Und: Wer wirklich Freiheit will, muss die Welt so verändern, dass niemand ausgeschlossen bleibt.
Behinderung entsteht also in der Beziehung zwischen Körper und Umwelt.
Sie ist kein biologisches Schicksal, sondern Ausdruck sozialer Machtverhältnisse – ähnlich wie Sexismus oder Rassismus.
Max: Also, das klingt ja alles ganz nett – „die Welt soll für alle gemacht sein“ und so. Aber mal ehrlich: Wie soll das gehen? Eine Welt, die wirklich auf alle Rücksicht nimmt? Das ist doch utopisch. Man kann doch nicht jeden Bürgersteig, jedes Auto, jedes Spielzeug so designen, dass alle es benutzen können.
Lena: Ich versteh, was du meinst. Aber das ist ja auch kein „alles oder nichts“-Ziel. Es geht nicht darum, perfekt zu werden, sondern darum, Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen, die man sonst gar nicht sieht, weil man selbst nicht betroffen ist.
Max: Hm. Aber wo hört das auf? Wenn jemand zum Beispiel keine lauten Geräusche erträgt, darf’s dann keine Musik mehr in der Stadt geben?
Lena (lächelt schief): Du hast die „Max-typische“ Frage gefunden. Wendell würde wahrscheinlich sagen: Es geht nicht darum, dass die Welt still wird – sondern dass man merkt, dass nicht alle das gleiche brauchen, um sich wohlzufühlen. Vielleicht bräuchte man leise Zonen oder Kopfhörer, die kostenlos ausgeteilt werden. Kleine Veränderungen, die Großes bewirken.
Max: Klingt trotzdem ein bisschen wie Sozialromantik. Ich mein, Menschen sind halt unterschiedlich. Und das Leben ist nicht fair – das lernt man schon im Kindergarten.
Lena: Ja, aber das ist genau der Punkt: Wir nehmen diese Ungerechtigkeit als Naturgesetz hin. Dabei ist vieles davon menschengemacht. Wendell sagt ja, Behinderung entsteht erst, weil die Welt so gebaut ist, dass sie manche ausschließt.
Max (nickt langsam): Okay, aber selbst wenn ich das akzeptiere – was ändert das konkret?
Lena: Zum Beispiel, wie du über Menschen denkst. Erinnerst du dich an das Sportfest in der Grundschule, als Lukas im Rollstuhl nicht mitmachen durfte?
Max: Oh ja. Der Lehrer meinte damals, er solle halt „anfeuern“. Ich fand das echt peinlich.
Lena: Genau. Das war kein Naturgesetz – das war eine Entscheidung. Eine andere Schule hätte vielleicht einen inklusiven Wettbewerb gemacht.
Max: Stimmt. Lukas war trotzdem besser gelaunt als alle anderen.
Lena (lächelt): Eben. Und trotzdem wurde er ausgeschlossen, obwohl es leicht hätte anders laufen können.
Max (nachdenklich): Ich erinnere mich auch an die Nachbarin von Oma – die mit dem Gehstock. Alle haben immer so überdeutlich mit ihr geredet, als wäre sie schwerhörig oder blöd.
Lena: Ja. Das nennt Garland-Thomson den „Blick des Mitleids“. Er klingt freundlich, aber eigentlich macht er einen Menschen kleiner.
Max: Also, Ableismus ist nicht nur das, was man tut, sondern auch, wie man guckt?
Lena: Ganz genau. Es ist ein Denken, das trennt: „die Normalen“ hier, „die Behinderten“ da. Und das Schlimme ist, dass fast alle das unbewusst mitmachen.
Max (schaut zu Humboldt, der – halb blind, aber neugierig wie immer – gemächlich an einer Pfütze schnüffelt): Irgendwie ist das wie bei Tieren. Wir entscheiden einfach, wer dazugehört und wer nicht.
Lena: Stimmt, da gibt’s Parallelen. Nur dass es hier um Menschen geht, die mitten unter uns leben und trotzdem oft unsichtbar sind.
Max: Aber sag mal ehrlich: Würdest du wollen, dass alle Menschen als „behindert“ gelten? So nach dem Motto: Jeder hat irgendeine Einschränkung?
Lena: Warum nicht? Das würde bedeuten, dass niemand perfekt sein muss, um dazuzugehören. Wendell nennt das „Verletzlichkeit als Teil des Menschseins“. Ich find das schön.
Max: Klingt poetisch. Aber auch ein bisschen deprimierend.
Lena (grinst): Willkommen in der Philosophie.
Max: Okay, aber wie würde das konkret aussehen – so eine Welt ohne Ableismus?
Lena (überlegt kurz): Vielleicht so: Barrieren wären der Ausnahmefall, nicht die Regel. Menschen würden nicht mehr sagen „trotz Behinderung“, sondern einfach „mit Behinderung“. Und die Frage wäre nicht „Wie können sie sich anpassen?“, sondern „Wie kann die Welt sich anpassen?“
Max: Und wenn jemand sagt, das sei zu teuer oder zu umständlich?
Lena: Dann würde ich fragen: Für wen ist es gerade bequem, dass es so bleibt?
Ein Windstoß. Humboldt hebt kurz den Kopf, als wolle er zustimmen.
Max (leise): Ich glaub, ich hab nie wirklich drüber nachgedacht, wie viel Glück man hat, wenn man einfach reinpasst.
Lena: Das ist der erste Schritt. Philosophie fängt immer da an, wo man merkt, dass das „Normale“ nicht selbstverständlich ist.
Max: Hm. Dann bin ich wohl schon fast Philosoph.
Lena (schmunzelt): Fast. Aber du brauchst noch einen Rollkragenpulli.
Max: Nur wenn Humboldt auch einen kriegt.

Philosophische Wurzeln: Warum manche denken, dass nicht alle Menschen gleich sind
„Alle Menschen sind gleich“ geht uns leicht über die Lippen. Das klingt fair, gerecht – und irgendwie selbstverständlich. Doch das war nicht immer so. In der Geschichte der Philosophie gibt es zahlreiche Denker, die das ganz anders gesehen haben.
Einer der berühmtesten Philosophen, die von einer „natürlichen“ Ungleichheit der Menschen ausgingen, war Platon. Sein Konzept eines idealen Staates ist radikal: Es beruht nicht auf Gleichheit, sondern auf einer strikten Hierarchie, in der jeder Mensch eine festgelegte Rolle hat. Doch warum dachte Platon so – und was bedeutet das für unsere heutige Gesellschaft?
Platons Staatsideal: Eine Welt, in der nicht jeder alles tun kann
Platon (*427 v. Chr.) gehört zu den einflussreichsten Denkern der Philosophiegeschichte. In seinem Werk „Politeia“ („Der Staat“) beschreibt er sein Ideal einer perfekten Gesellschaft – und die ist alles andere als demokratisch.
Für Platon sind nicht alle Menschen gleich, sondern von Natur aus unterschiedlich begabt. Diese Unterschiede bestimmen für ihn, welchen Platz ein Mensch in der Gesellschaft einnehmen sollte.
Drei Klassen – Drei Funktionen
Platon teilt die Gesellschaft in drei streng voneinander getrennte Gruppen:
- Die Herrscher (Philosophenkönige) – Sie sind die klügsten und weisesten Menschen, die allein wissen, was gut für die Gesellschaft ist. Ihnen steht die politische Macht zu.
- Die Wächter (Krieger) – Sie sind mutig, stark und verteidigen den Staat nach außen und innen.
- Die Arbeitenden (Bauern, Handwerker, Händler) – Sie sorgen für Nahrung, Werkzeuge, Gebäude und alles andere, was das Leben braucht.
Platon hält diese Einteilung für natürlich. Jeder Mensch wird mit bestimmten Fähigkeiten geboren und soll genau das tun, wofür er gemacht ist. Die perfekte Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder an seinem Platz bleibt.
Das bedeutet:
- Ein intelligenter, weiser Mensch sollte kein Bauer sein – das wäre eine Verschwendung.
- Ein mutiger, starker Mensch sollte kein Herrscher sein – denn er versteht nicht, was gerecht ist.
- Ein Bauer sollte sich nicht in politische Angelegenheiten einmischen – denn er hat nicht das Wissen dazu.
Platon geht sogar noch weiter: Kinder sollen nicht von ihren leiblichen Eltern erzogen werden, sondern vom Staat – damit sie ohne Beeinflussung durch ihre Herkunft die Rolle einnehmen, für die sie „bestimmt“ sind.
Warum Platon das für gerecht hielt
Platon glaubte nicht an Demokratie. Für ihn war sie ein chaotisches System, in dem ungebildete Massen nach ihren Launen entscheiden – oft zum eigenen Schaden.
Sein Argument: Würdest du ein Schiff lieber von einem erfahrenen Kapitän steuern lassen oder von einer Gruppe zufälliger Passagiere, die darüber abstimmen, wohin es geht?
Für Platon war der Staat wie ein Schiff: Er sollte von denen gelenkt werden, die es wirklich können – also den Philosophen.
- Gerechtigkeit bedeutet für Platon nicht Gleichheit, sondern dass jeder seine Aufgabe erfüllt und nicht in die Rolle eines anderen hineindrängt.
- Bildung ist der Schlüssel: Nur die klügsten Menschen sollten die Macht haben – aber nicht, um sich zu bereichern, sondern um das Beste für alle zu tun.
Platon war überzeugt, dass die meisten Menschen sich von ihren Begierden, Emotionen und Vorurteilen leiten lassen – und deshalb unfähig sind, weise politische Entscheidungen zu treffen.
Kurz gesagt: Der Staat funktioniert nur, wenn jeder das tut, wofür er geschaffen ist.
Warum wir das heute problematisch sehen
Platons Idee klingt erstmal logisch: Warum sollte nicht der regieren, der am klügsten ist? Warum sollte nicht derjenige kämpfen, der am mutigsten ist?
Doch aus heutiger Sicht steckt in Platons Modell ein großes Problem: Es gibt keine Möglichkeit, diese Einteilung zu hinterfragen oder zu verändern.
Kritikpunkt 1: Wer entscheidet, wer wofür gemacht ist?
Platon behauptet, dass sich die Rollen von selbst ergeben. Aber was, wenn ein Bauer eigentlich philosophisch hochbegabt ist? Oder ein Krieger klüger als der Herrscher?
In einer Gesellschaft, die Menschen „natürlich“ in Klassen einteilt, gibt es keine Durchlässigkeit – und damit keine echte Gerechtigkeit.
Kritikpunkt 2: Ungleichheit als Naturgesetz
Platon argumentiert, dass Menschen von Geburt an für bestimmte Aufgaben vorgesehen sind. Diese Sichtweise ist gefährlich, weil sie Ungleichheit rechtfertigt.
Ein Beispiel: Stell dir vor, jemand behauptet: „Frauen sind von Natur aus emotional und daher ungeeignet für Führungspositionen.“ Das ist eine platonische Argumentation – und eine, die noch heute in vielen Bereichen der Gesellschaft zu finden ist.
Kritikpunkt 3: Freiheit und Selbstbestimmung fehlen
Was, wenn jemand nicht in seine vorhergesehene Rolle passt? Was, wenn ein „Arbeiter“ doch regieren will? Platon gibt darauf keine Antwort – weil sein Modell keine individuelle Freiheit vorsieht.
Und heute? Platons Einfluss auf die Geschichte
Trotz der Kritik hatte Platons Staatsmodell großen Einfluss:
- Im Mittelalter wurde seine Idee von einer gottgegebenen Ordnung übernommen: Die Kirche und der Adel regierten, die Bauern arbeiteten.
- In totalitären Staaten wurden ähnliche Hierarchien errichtet: Eine „Elite“ trifft die Entscheidungen, die „einfachen Leute“ sollen gehorchen.
- Selbst heute wird oft argumentiert, dass manche Menschen „von Natur aus“ für bestimmte Aufgaben besser geeignet sind.
Aber: Moderne Demokratien beruhen genau auf der Idee, die Platon ablehnte – nämlich, dass alle Menschen grundsätzlich gleich sind und gleiche Rechte haben.
Was denkst du?
- Platons Idee, dass nur die Klügsten regieren sollten – ist das vielleicht gar nicht so falsch? Würde unsere Welt besser funktionieren, wenn es eine „Elite der Vernünftigen“ gäbe?
- Oder ist Gleichheit doch wichtiger als Kompetenz? Sollte jeder mitbestimmen können, selbst wenn manche vielleicht bessere Entscheidungen treffen würden als andere? Was hältst du zum Beispiel von der Frauenquote in Politik und Wirtschaft?
- Gibt es in unserer Gesellschaft heute noch „unsichtbare Hierarchien“, die Platons Modell ähneln? (Zum Beispiel durch Herkunft, Geschlecht oder soziale Klasse?)
Platon glaubte, dass der Staat nur mit einer strikten Ordnung funktionieren kann – doch unsere Welt ist komplizierter. Wo ziehen wir die Grenze zwischen gerechter Struktur und ungerechter Einschränkung?
Lena und Max sitzen im Park. Der alte Humboldt döst in der Sonne, während Max mit dem Fuß sein Skateboard hin- und herrollt. Lena hat ein Buch auf dem Schoß: Platons Politeia.
Max (grinst): Also, Platon wollte echt, dass jeder nur das macht, wofür er „geschaffen“ ist? Heißt das, ich dürfte dann nur noch Skateboard fahren, weil ich da Talent hab?
Lena (lacht): Na ja, so ungefähr. Platon meinte, eine Gesellschaft funktioniert am besten, wenn jeder das tut, wozu er am besten geeignet ist – und nicht in Dinge reinpfuscht, von denen er keine Ahnung hat.
Max: Klingt ja erstmal logisch. Aber was, wenn ich irgendwann keine Lust mehr auf „Skater“ hab und lieber „Philosoph“ sein will?
Lena: Genau das ist der Haken. Platon glaubte, dass das Gemeinwohl über dem Einzelnen steht. Wenn du also als Skater gut fürs Ganze bist – Pech, dann bleibst du dabei.
Max: Puh … Und wer entscheidet das? ’Ne Art antiker Berufsberater mit Orakel-Zertifikat?
Lena (schmunzelt): Fast. In Platons Idealstaat übernehmen das die Philosophen – also die, die die Wahrheit erkennen können. Er nannte sie die „Wächter“, die die Gesellschaft lenken sollen, weil sie wissen, was wirklich gerecht ist.
Max (zieht die Augenbraue hoch): Ah, klar! Weil Philosophen ja immer wissen, was richtig ist. Dann hätten wir also ’ne Elite, die bestimmt, was gut für uns ist? Klingt irgendwie … nach Diktatur in Sandalen.
Lena: Das ist der große Kritikpunkt. Platons Idee klingt edel – alle handeln für das Gute –, aber praktisch bedeutet sie, dass die meisten Menschen nicht mitentscheiden dürfen. Demokratie war nicht sein Ding. Er fand, die Masse sei zu unvernünftig. Gleichheit würde Platons Meinung nach die Ordnung durcheinanderbringen. Er dachte: Wenn jeder alles machen darf, funktioniert das Ganze nicht mehr.
Max: Aber das ist doch voll elitär!
Lena: Da hast du recht. Platon wollte eine Gesellschaft, in der jeder seinen festen Platz hat – und diesen Platz soll man akzeptieren. Er dachte, Gleichheit sei eine Illusion, weil Menschen nun mal unterschiedlich begabt sind.
Max: Ja klar, unterschiedlich schon. Aber ungleich viel wert? Das ist doch was ganz anderes! Nur weil jemand gut rechnen kann, ist er doch nicht wichtiger als jemand, der gut Bretter wachsen kann.
Lena: Das ist jetzt deine moderne Sicht. In unserer heutigen Philosophie – und auch in der Politik – sehen wir Gleichheit als Grundprinzip: Jeder Mensch hat denselben Wert, unabhängig davon, was er kann. Und genau deshalb kritisieren viele Philosophen ihn bis heute. Weil seine Idee von Ordnung auf Ungleichheit basiert.
Max: Also wäre Platon heute wahrscheinlich total genervt von Gleichberechtigung, Demokratie und so?
Lena: Wahrscheinlich schon. Er würde sagen, dass wir zu chaotisch, zu laut und zu sehr von unseren Meinungen überzeugt sind. Aber vielleicht würde er auch staunen, wie viele Menschen heute überhaupt mitreden dürfen.
Max (steht auf, schnippt mit dem Board): Also ich bin lieber ein freier Skater als ein gehorsamer Wächter. Wenn Platon mich bremsen will, soll er’s versuchen.
Lena (lacht): Ich glaub, du wärst Platons Albtraum.

Nietzsche und die Kritik an der Gleichheitsmoral
Die meisten philosophischen Strömungen, die sich mit Gleichheit befassen, argumentieren dafür: Sie betonen die Würde jedes Menschen, seine Rechte und den moralischen Anspruch auf Gleichbehandlung. Doch es gibt noch eine radikale Gegenposition – und die stammt von keinem Geringeren als Friedrich Nietzsche (*1844). In seinen Werken rüttelt er an den Grundfesten unserer Moralvorstellungen – und stellt unbequeme Fragen. Wer sich mit Nietzsche beschäftigt, muss bereit sein, heilige Kühe zu schlachten. Und genau das tun wir jetzt.
Gleichheit als Hemmnis für Größe?
Nietzsche glaubte, dass eine Gesellschaft, die auf Gleichheit setzt, automatisch Mittelmäßigkeit hervorbringt. Denn wenn niemand mehr herausstechen darf, werden außergewöhnliche Menschen daran gehindert, ihr Potenzial zu entfalten.
Darwin, aber für Menschen
Man kann sagen: Nietzsche dachte evolutionär. So wie in der Natur die stärksten und anpassungsfähigsten Lebewesen überleben, so sollten auch die fähigsten Menschen ihre Talente voll entfalten können, anstatt sich für andere kleinzumachen. Für ihn war Fortschritt nur möglich, wenn sich die Starken nicht von den Schwachen zurückhalten lassen. Gleichheit bedeutete für ihn nicht Gerechtigkeit, sondern Stillstand.
Ein Beispiel: Stell dir vor, ein überragender Fußballer würde absichtlich schlechter spielen, nur damit sich andere nicht minderwertig fühlen. Nietzsche hätte das für eine Tragödie gehalten.
Die Moral des Ressentiments – Warum Schwache Gleichheit fordern
Doch warum gibt es dann überhaupt die Idee der Gleichheit? Nietzsche hat darauf eine provokante Antwort: Weil die Schwachen sich gegen die Starken verschworen haben.
Er nennt das die Moral des Ressentiments.
Die Geburt der Moral aus Neid
Laut Nietzsche wurde die klassische Moral – insbesondere die christlich-abendländische – nicht von den Starken entwickelt, sondern von den Machtlosen und Unterdrückten.
- Die Schwachen konnten sich nicht gegen die Starken durchsetzen.
- Also erfanden sie eine Moral, die Stärke als „böse“ und Schwäche als „gut“ definierte.
- Dadurch wurde Mitleid zum höchsten Wert – und Selbstbewusstsein, Stolz oder Machtstreben wurden verteufelt.
Kurz gesagt: Die Schwachen konnten sich nicht körperlich oder intellektuell gegen die Starken behaupten – also kämpften sie mit Moral.
Gut und Böse – Ein Trick der Schwachen?
Nietzsche unterscheidet zwischen Herrenmoral und Sklavenmoral:
| Herrenmoral (starke Individuen) | Sklavenmoral (schwache Individuen) |
|---|---|
| Stärke ist gut | Mitleid ist gut |
| Stolz ist gut | Bescheidenheit ist gut |
| Selbstbestimmung ist gut | Gehorsam ist gut |
| Durchsetzungskraft ist gut | Anpassung ist gut |
Stell dir vor, du bist ein hervorragender Schüler. Wenn du zu selbstbewusst bist, sagen andere schnell: „Na, so toll bist du auch wieder nicht.“ – Warum? Weil dein Erfolg sie an ihre eigene Mittelmäßigkeit erinnert.
Nietzsche würde sagen: Die Forderung nach Gleichheit ist oft nichts anderes als ein verstecktes Ressentiment – ein Groll derjenigen, die nicht mithalten können.
Nietzsches Kritik an Mitleid und Opfermentalität
Ein zentraler Punkt seiner Kritik ist das Mitleid.
- In der christlichen Ethik gilt es als gut, sich um die Schwachen zu kümmern.
- Nietzsche hingegen sieht darin eine Verherrlichung der Schwäche.
- Wer andere „bemitleidet“, hält sie klein, anstatt ihnen zu helfen, stärker zu werden.
Er wendet sich gegen die Idee, dass Leid automatisch einen moralischen Wert hat. Ein Mensch, der leidet, ist nicht automatisch im Recht – und ein starker Mensch nicht automatisch ein Unterdrücker.
Ein Beispiel: Stell dir zwei Menschen vor, die ein hartes Leben hatten. Der eine wächst daran und wird stärker, der andere gibt sich der Opferrolle hin und fordert Mitleid. Nietzsche feiert den ersten und kritisiert den zweiten.
Nietzsche und die moderne Gesellschaft
Nietzsche war kein Demokrat – er glaubte nicht daran, dass alle Menschen gleich sind oder sein sollten. Aber bedeutet das, dass er Elitenherrschaft oder Unterdrückung befürwortete? Nicht unbedingt.
- Seine Kritik an Gleichheit sollte keine Rechtfertigung für Ungerechtigkeit sein, sondern ein Weckruf, eigene Stärken nicht zu unterdrücken.
- Er lehnte nicht Solidarität ab, sondern Bequemlichkeit und Selbstmitleid.
Heute stellt sich die Frage:
- Sind wir eine Gesellschaft, die außergewöhnliche Individuen fördert – oder eine, die lieber alle auf ein Mittelmaß herunterzieht?
- Gibt es Formen von „falschem Mitleid“, die Menschen eher schwächen als stärken?
Was denkst du?
Nietzsche bleibt eine der provokantesten Stimmen in der Philosophiegeschichte, denn er fordert uns heraus:
Braucht eine Gesellschaft Gleichheit – oder würde sie besser funktionieren, wenn man herausragende Individuen einfach machen ließe?
Max: Ey, Nietzsche mal wieder … War der eigentlich einfach nur arrogant oder hat der wirklich geglaubt, manche Menschen stehen über anderen?
Lena (grinst): Beides wahrscheinlich. Nietzsche fand, dass die moderne Gesellschaft zu sehr auf Gleichheit fixiert ist und dass sie dadurch das Außergewöhnliche plattmacht.
Max: Also, dass man nicht mehr besonders sein darf, weil sonst alle beleidigt sind?
Lena: Genau das war sein Punkt. Er meinte, die „Gleichheitsmoral“ – also diese Idee, alle müssten gleich sein – macht Menschen faul und mittelmäßig. Weil man sich nicht mehr traut, besser zu sein.
Max (sarkastisch): Klingt wie bei Schulnoten. Wenn alle gleich schlecht sind, kriegt keiner Ärger. Wenn einer zu gut ist, heißt’s gleich, er will sich wichtig machen.
Lena: Ja, das ist Nietzsches Kritik. Viele finden, dass er elitär war – oder schlimmer. Aber eigentlich ging’s ihm nicht um Macht über andere, sondern um Selbstüberwindung. Er wollte, dass Menschen ihre eigenen Werte schaffen, statt brav die moralischen Regeln der Masse zu befolgen.
Max: Also ein „Mach dein eigenes Ding“, aber auf philosophisch?
Lena: So ungefähr. Er hasste Gleichmacherei, wenn sie das Besondere zerstört. Aber er meinte nicht, dass Menschen ungleich viel wert sind. Nur, dass man sich nicht kleinmachen sollte, um reinzupassen.
Max (lehnt sich zurück): Ich find das trotzdem schwierig. Wenn jeder besser sein will, tritt doch am Ende einer den anderen platt.
Lena: Stimmt. Deswegen sagen viele, dass Nietzsche übertreibt. Er hat eine Rebellion im Kopf, kein Gesellschaftsmodell. Aber er zwingt uns, über Gleichheit nachzudenken: Wollen wir wirklich, dass alle gleich sind – oder wollen wir, dass jeder die Freiheit hat, mehr aus sich zu machen?
Max: Hm. Vielleicht ist Gleichheit gar nicht das Ziel, sondern die Startlinie. Damit alle loslaufen können. Und dann sieht man, was jeder draus macht.
Und … was bedeutet „Gleichheit“ jetzt?
Gleichheit klingt so simpel. Und gleichzeitig ist das einer der kompliziertesten Begriffe, die es gibt. Denn Gleichheit bedeutet nicht, dass alle identisch sind oder dass niemand stärker oder begabter sein darf. Gleichheit heißt, dass jeder Mensch (und jedes fühlende Wesen) als gleich wertvoll angesehen wird. Dass niemand von vornherein weniger zählt.
Mary Wollstonecraft wollte, dass Frauen dieselben Chancen wie Männer haben, ihren Verstand zu nutzen.
Simone de Beauvoir zeigte, dass „Frau-Sein“ kein Schicksal ist, sondern eine gesellschaftliche Rolle.
Peter Singer forderte, dass auch Tiere moralisch zählen, wenn sie Leid empfinden können.
Und Martha Nussbaum erinnerte daran, dass echte Gleichheit erst beginnt, wenn alle ihre Fähigkeiten entfalten können – nicht nur die, die ohnehin schon privilegiert sind.
Gleichheit bedeutet also: Jede Person dort abholen, wo sie steht – und ihr ermöglichen, sie selbst zu sein.
Philosophisch gesehen ist Gleichheit kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess: Wir müssen immer wieder neu prüfen, wo wir Menschen (oder Tiere) ausschließen, benachteiligen oder übersehen. Und dabei ehrlich bleiben, auch mit uns selbst. Denn Ungleichheit steckt oft in Dingen, die wir für „normal“ halten.
Nietzsche hätte wahrscheinlich gelacht über das Gerede von Gleichheit. Aber vielleicht ist genau das die Herausforderung: Gleichheit ist keine Einladung zur Mittelmäßigkeit, sondern zur Menschlichkeit. Sie fordert uns auf, Unterschiede zu respektieren – ohne daraus Hierarchien zu machen.
Oder, um es anders zu sagen: Gleichheit bedeutet nicht, dass alle denselben Weg gehen müssen – sondern dass niemand auf halber Strecke stehen gelassen wird.
- Das Zitat stammt aus Olympe de Gouges‘ „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ (französischer Originaltitel: „Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne“), die sie 1791 veröffentlichte. Es handelt sich um den ersten Artikel dieser Erklärung. ↩︎
- Das Zitat stammt aus Simone de Beauvoirs Werk „Das andere Geschlecht“ (französischer Originaltitel: „Le Deuxième Sexe“), das 1949 veröffentlicht wurde. Es steht zu Beginn des zweiten Bandes im Abschnitt „Formierung“ unter „Kindheit“. ↩︎
- Der Existenzialismus ist eine Richtung der Philosophie, die fragt: Was bedeutet es, wirklich man selbst zu sein? Statt feste Regeln oder göttliche Pläne zu akzeptieren, sagt der Existenzialismus: Der Mensch erschafft sich selbst durch seine Entscheidungen. Wir sind nicht „vorgefertigt“. Erst durch das, was wir tun, werden wir zu dem, was wir sind. Wichtig dabei: Diese Freiheit ist großartig, aber auch anstrengend – denn sie heißt, dass wir selbst Verantwortung für unser Leben tragen. ↩︎
- Das gilt auch für Filme. Kennt ihr den Bechdel-Test? Dieser Test prüft, ob ein Film (oder eine Serie) Frauen nicht nur als Statistinnen im Leben von Männern darstellt. Er besteht aus drei einfachen Fragen: Gibt es mindestens zwei weibliche Figuren? Sprechen sie miteinander? Und reden sie dabei über etwas anderes als einen Mann? Unfassbar viele Filme scheitern an diesen drei simplen Punkten – was zeigt, wie männlich zentriert viele Geschichten immer noch sind. ↩︎
- Rawls vertritt die Chancengleichheit (das Leitbild der liberalen Denktradition), die aber unterschiedliche Ergebnisse (also Ungleichheit) akzeptiert, solange die Chancen fair verteilt sind. Dagegen kritisierte Karl Marx, dass Chancengleichheit allein nicht genügt, weil die Ausgangsbedingungen der Menschen (z. B. Herkunft, Geschlecht, Reichtum oder Armut) so unterschiedlich sind, dass gleiche Chancen nie zu gleichen Ergebnissen führen würden. Sein Ziel sah er in der Aufhebung von materiellen Ungleichheiten, sodass Besitz, Einkommen und Einfluss annähernd gleich verteilt werden (Ergebnisgleichheit). ↩︎
- Das bedeutet hier nicht, dass es um Frauenrechte geht, sondern dass sie – wie viele feministische Denkerinnen – gesellschaftliche Machtverhältnisse hinterfragen: Wer gilt als „normal“ und wer wird ausgeschlossen? Feministinnen machen sichtbar, wie Strukturen manche Menschen benachteiligen – egal ob wegen Geschlecht, Herkunft oder Körper. ↩︎
Wenn dich das Thema Gleichheit gepackt hat und du tiefer einsteigen willst, findest du hier eine kleine, aber feine Auswahl an Büchern, die zeigen, wie unterschiedlich Philosoph/innen über Gleichheit denken – von den ersten Feministinnen bis zu modernen Ethikerinnen. Keine Angst: Die meisten Texte gibt’s auch in verständlichen Ausgaben oder als gute Sekundärliteratur.
- Mary Wollstonecraft – A Vindication of the Rights of Woman (1792)
Ein Klassiker des frühen Feminismus: Wollstonecraft fordert Bildung und Selbstständigkeit für Frauen – in einer Zeit, in der das revolutionär war. Ihre Argumente bilden die Grundlage für spätere Gleichheitsdebatten. - Simone de Beauvoir – Das andere Geschlecht (1949)
Eines der wichtigsten Werke der modernen Philosophie: De Beauvoir analysiert, wie Frauen zu dem gemacht werden, was sie gesellschaftlich „sein sollen“. Ihr Satz „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ wurde weltberühmt. - Friedrich Nietzsche – Jenseits von Gut und Böse (1886)
Ein provokantes Werk, das zum Nachdenken zwingt: Was, wenn Gleichheit nicht immer gut ist? - Peter Singer – Die Befreiung der Tiere (1975)
Singer argumentiert, dass auch Tiere gleiches Leid empfinden können – und ihre Interessen deshalb moralisch berücksichtigt werden müssen. Ein Schlüsseltext der modernen Tierethik. - Martha C. Nussbaum – Frontiers of Justice (2006)
Nussbaum entwickelt ihren „Fähigkeitenansatz“ weiter und fragt, wie Gesellschaften gestaltet sein müssen, damit jeder Mensch die Chance auf ein gutes Leben hat. - Rosemarie Garland-Thomson – Extraordinary Bodies (1997)
Ein einflussreiches Werk über Ableismus. Garland-Thomson zeigt, wie das Bild des „normalen Körpers“ entstanden ist – und warum es so gefährlich ist. - Susan Wendell – The Rejected Body (1996)
Wendell verbindet Philosophie, Feminismus und Krankheitsforschung: Sie erklärt, warum viele Behinderungen nicht „natürlich“, sondern gesellschaftlich gemacht sind. - Platon – Politeia/Der Staat (ca. 380 v. Chr.)
Eines der ältesten Werke zur politischen Philosophie. Platon beschreibt eine Gesellschaft, in der jeder seine Rolle hat – ein spannender Ausgangspunkt, um über Gleichheit und Ungleichheit nachzudenken.
Hinterlasse einen Kommentar